Das Teufelsspiel (Lincoln Rhyme 6)
- Blanvalet
- Erschienen: Januar 2006
- 33
- London: Hodder & Stoughton, 2005, Originalsprache
- München: Blanvalet, 2006, Seiten: 480, Übersetzt: Thomas Haufschild
- München: Blanvalet, 2007, Seiten: 536


Der unfreiwillige König der ´Armchair-Detectives´ kehrt zurück
Thompson Boyd, ein erfolgreicher Profikiller, attackiert im Museum für Afroamerikanische Geschichte von New York die sechzehnjährige Schülerin Geneva Settle. Sie kann ihm entkommen, doch Boyd bleibt ihr unerbittlich auf den Fersen. Menschen sterben oder werden schwer verletzt - dem gefühlskalten, äußerst methodisch vorgehenden Mörder ist es gleichgültig
Boyd muss unbedingt außer Gefecht gesetzt werden. Die Polizei wendet sich Hilfe suchend an Lincoln Rhyme. Der geniale Ermittler ist nach einem Unfall zwar vom Hals abwärts gelähmt, doch er hat mit Hilfe modernster Technik zu seinem Beruf zurückgefunden. Rhyme zur Seite stehen seine Lebensgefährtin, die Polizistin Amelia Sachs, und ein Team entschlossener Fahndungsspezialisten.
Doch Boyd erweist sich lange als Phantom. Er hinterlässt keine Spuren, seine Biografie hat er systematisch gelöscht. Auf der anderen Seite erweist sich Geneva, seine Zielperson, als schwieriger Schützling für die Polizei. Sie will nicht untertauchen, sondern ihr normales Leben fortsetzen. Die Hartnäckigkeit, welche sie dabei an den Tag legt, hat ihren Grund. Geneva verbirgt gleich zwei Familiengeheimnisse, wobei das eine erhebliche politische Brisanz aufweist: Offenbar ist ihr Vorfahre, der Ex-Sklave und Bürgerkriegsveteran Charles Singleton, in eine Verschwörung geraten, deren Gelingen noch 140 Jahre später für viele Bürger der Vereinigten Staaten eine erhebliche Aushöhlung ihrer bürgerlichen Rechte zur Folge hätte. Die Kenntnis dieser historischen Vorgänge ist so brisant, dass die wenigen Menschen, die darüber informiert sind, keine Mitwisser dulden.
Da Geneva ihre Situation nicht richtig einzuschätzen weiß, sind Zwischenfälle quasi vorprogrammiert. Mit teuflischem Geschick stellt Boyd seinem Opfer immer wieder Todesfallen. Auf der anderen Seite kommt ihm Rhyme indes langsam aber sicher auf die Spur. Der Wettlauf muss rasch entschieden werden, bevor die Zahl der Opfer weiter steigt - und weil sich herausstellt, dass die Ursache für die Hetzjagd auf Geneva auch eine ganz andere sein könnte ...
Falsche Spuren, die niemanden mehr überraschen
Die meisten Verfasser eines Thrillers stehen vor dem Problem eine möglichst verwickelte Handlung in ein gleichermaßen spannendes wie logisches Finale einmünden zu lassen. Jeffery Deaver kämpft diesbezüglich in einer ganz anderen Klasse: Er lässt seine Geschichte mindestens zwei, besser aber mehr Haken schlagen. Dieses Mal sind es übrigens vier.
Kann das klappen? Der erfahrene Leser von Thrillern ist skeptisch - und das mit gutem Grund. Vier Auflösungen vervierfachen nicht zwangsläufig den Lektürespaß, sie steigern auch die Möglichkeit sich zu verzetteln. Soll heißen: Die endgültige Lösung des Rätsels muss schon verflucht gut sein, damit die mehrfache nachträgliche Neuinterpretation des Geschehens nicht zum Selbstzweck verkommt.
Jeffery Deaver kann leider - und dies nicht zum ersten Mal - kaum für sich beanspruchen, dieses Problem gemeistert zu haben. Ganz groß ist er wieder im Aufbau von Spannung. Die ersten 400 Seiten von Das Teufelsspiel lesen sich blendend. Der Verfasser versteht es ausgezeichnet den uralten "Whodunit?" mit dem modernen Thriller zu verknüpfen. Lincoln Rhyme ist der ultimative "Armchair-Detective". Er bleibt an den Rollstuhl gefesselt und kann buchstäblich kein Glied rühren.
Action mit CSI-Touch: Deavers Stärke
Trotzdem beherrscht er das Geschehen, denn er ist der Magier der Hightech-Ermittlungsarbeit. Rhyme gab es schon vor dem Siegeszug der Gerichtsmediziner und sonstigen Laborforscher mit Waffenschein, der in gleich drei CSI-Fernsehserien seinen aktuellen Höhepunkt gefunden hat. Er profitiert von der Faszination, welche die Verbrecherjagd per Mikroskop, Klebedampf und Spektralanalyse ausstrahlt. Zudem bemüht sich Deaver redlich die reale Supertechnik durch Science Fiction-Elemente noch interessanter zu gestalten. Die langweilige Laborrealität mit ihren öden Routinen bleibt außen vor; Genie und Zufall treiben das Geschehen immer wieder voran. Ohnehin prägen Dynamik und Geschwindigkeit die typische Deaver-Story. Zwar ist die Hauptfigur bewegungsunfähig, doch Rhymes Gefährten im Kampf gegen das Verbrechen gleichen das mehr als aus. Verfolgungsjagden gehören ebenso zum Repertoire wie spektakuläre Schießereien.
Einen begehrlichen Seitenblick wirft Deaver - sicher ist sicher - darüber hinaus auf die Dan-Brown-Fraktion seiner potenziellen Leser. Historische Mysterien, die ihre Schatten bis in die Gegenwart werfen, sind gerade "in". Wenigstens jagen Rhyme & Co. zur angenehmen Abwechslung keiner vom Vatikan unterdrückten Alternativbibel hinterher. Er hat ein deutlich aktuelleres Rätsel konstruiert, das zumindest diejenigen Leser überzeugt, die mit der politischen Geschichte der Vereinigten Staaten nicht wirklich vertraut sind und vor allem überzeugend klingt.
Figuren ohne Tiefe: Deavers Schwäche
Deaver und seine Figuren - seit jeher für die Leser ein Wechselbad unterschiedlicher Gefühle. Gut fährt der Verfasser stets, wenn er seiner Figuren handeln lässt. Mit der Darstellung von Gefühlen hat er dagegen Schwierigkeiten. In Das Teufelsspiel stellt Deaver die persönlichen Probleme seiner beiden Hauptfiguren nicht mehr so deutlich in den Vordergrund wie sonst - eine kluge Entscheidung, denn in einem Punkt hat sich der Verfasser sicherlich in eine Sackgasse manövriert: Lincoln Rhyme wird trotz Wunderrollstuhl niemals aktiv ins Geschehen eingreifen können. In den beiden Auftaktbänden konnte Deaver noch abseits der kriminalistischen Handlung sehr anschaulich die selbstmörderische Verzweiflung thematisieren, die Rhyme angesichts seiner Behinderung spürte. Doch darauf konnte er nicht ewig herumreiten. Rhyme hat sich arrangieren müssen und können. Was macht ihn weiterhin interessant?
Zum einen setzt Deaver auf medizinische Zwischenfälle oder Rückschläge. Mal wird Rhyme ernsthaft krank, dann wieder erlebt er einen kleinen Durchbruch. In Das Teufelsspiel gelingt ihm die "Wiederbelebung" einer Hand. Das wird ausgiebig - im Film würde dramatische Musik eingespielt - und in Anwesenheit seiner Lebensgefährtin Amelia Sachs inszeniert. Über den Realismus einer Beziehung zwischen einem Kopfmenschen und einer bildhübschen Rennfahrerpolizistin sei an dieser Stelle nicht weiter philosophiert; Deaver hat es nun einmal so eingefädelt. Sachs ersetzt Rhyme am Tatort Augen und Beine. Damit sie nicht gar zu perfekt gerät, lässt der Verfasser es arthritisch in ihren Gelenken krachen.
Die richtig großen Gefühlsaufwallungen überlässt Deaver dieses Mal Sachs’ Polizeikollegen Lon Sellitto, dem brummigen Cop mit dem Herzen aus Gold. Der erlebt während einer Schießerei einen Nervenzusammenbruch, wobei schwer nachvollziehbar bleibt, wieso es ihn gerade jetzt trifft; der gute Mann hat schon ganz andere Kalamitäten durchstehen müssen und das nur mit zynischen Polizistensprüchen kommentiert. Als Figur bleibt Sellitto zudem zu sehr Klischee, so dass sich der Leser um ihn im Grunde keine Sorgen machen möchte.
Deavers Schwierig- bzw. Unfähigkeit in der Schilderung überzeugender Gefühle wird noch deutlicher in der Person der Geneva Settle. Den meisten Autoren misslingt die literarische Schöpfung eines jugendlichen Menschen. Aufgesetztes "unkonventionelles" Verhalten und stets peinlich missratender Jungsprech sind das Ergebnis. Geneva ist zudem weniger ein Mensch als ein Bündel wandelnder politischer Korrektheiten. Sie ist schwarz, geradezu manisch fleißig in der Schule, jeglichem Sex vor dem Abschluss abhold und birst vor menschenrechtlicher Empörung. Deaver bemüht sich zu verdeutlichen, wieso Geneva so (geworden) ist. Doch lesen wir ihre emotionsgeschwängerten Diskussionen mit dem lange verlorenen Vater - Passagen, die tunlichst übersprungen werden sollten und auch können, da sie für die Handlung absolut irrerelevant sind -, wünschen wir uns doch insgeheim, dass Thompson Boyd ein wenig erfolgreicher wäre ...
Der Mörder genießt als literarische Gestalt einen gewissen Popularitätsvorteil. Vor allem im Vergleich mit der schrecklich nüchternen Geneva ist Boyd eindeutig die interessantere Figur. Deaver bemüht sich auch hier - und dieses Mal mit mehr Erfolg - um ein "dreidimensionales" Charakterbild. Boyd arbeitet als Killer effektiv wie eine Maschine, ist aber keine, sondern ein seelisch kranker Mensch, der sich selbst nach Heilung sehnt. Dass er gleichzeitig seinem Job nachgeht, lässt ihn erfrischend ambivalent wirken: In diesem Punkt macht Deaver keine politisch korrekten Zugeständnisse. Diese Konsequenz ist sehr hilfreich wenn es gilt, die letzten 100, 150 Seiten von Das Teufelsspiel hinter sich zu bringen und sich nicht gar zu sehr über die zunehmende Holprigkeit des Geschehens zu ärgern.

Jeffery Deaver, Blanvalet




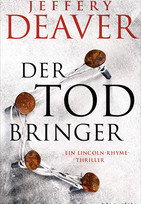










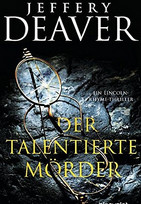

Deine Meinung zu »Das Teufelsspiel (Lincoln Rhyme 6)«
Wir freuen uns auf Deine Meinungen. Ein fairer und respektvoller Umgang sollte selbstverständlich sein. Bitte Spoiler zum Inhalt vermeiden oder zumindest als solche deutlich in Deinem Kommentar kennzeichnen. Vielen Dank!