Der 31. Februar
- Rowohlt
- Erschienen: Februar 1989
- 0
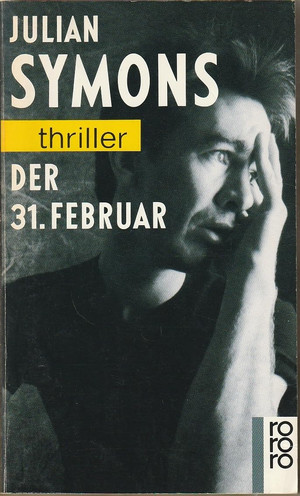
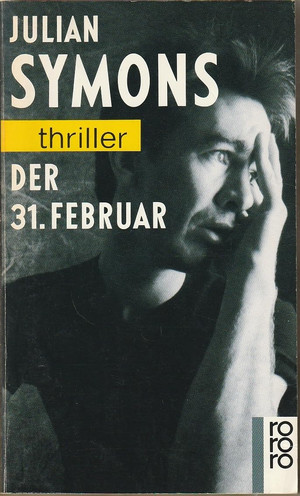
Lästige Gattin, tote Gattin, hartnäckige Gattin.
Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, auch in England kehrt man zum Alltag zurück. Die Fabriken arbeiten auf Hochtouren, weshalb die Produkte sich nicht mehr von selbst verkaufen. Für die Werbung brechen goldene Zeiten an. Auch „Vincent Werbung“ bemüht sich um ein möglichst großes Stück des Kuchens. Über die Qualität der angepriesenen Waren macht man sich keine Illusionen, dennoch gibt zumindest die Geschäftsführung vor, entsprechende Wertvorstellungen zu vertreten.
Andy Anderson, Leiter der Textabteilung, weiß es besser. Er sitzt in den Startlöchern und lauert auf einen Posten in der Chefetage, wo die Arbeitsleistung weniger wichtig ist als ein entsprechendes Auftreten. Anderson ist ausgebrannt und weiß, dass die von ihm eingebrachten Texte ihre frühere Durchschlagskraft vermissen lassen. Der Aufstieg dorthin würde ihn seiner Pflicht entheben, wo er seine Existenzberechtigung nicht mehr durch Qualitätsnachweise unter Beweis stellen müsste.
Immerhin kann Anderson derzeit auf persönliche Probleme pochen: Keinen Monat liegt es zurück, dass Gattin Valerie daheim auf der steilen Treppe zu Fall kam, als sie eine Flasche Wein aus dem Keller holen wollte. Mit gebrochenem Genick blieb sie liegen - ein tragischer Unfall, wie die polizeiliche Untersuchung ergab, obwohl gewisse Verdachtsmomente nicht ausgeräumt werden konnten.
In der Tat weiß Anderson mehr über Valeries Tod, als juristisch gut für ihn ist. Zwar fühlt er sich sicher, aber ausgerechnet im Büro scheint es jemanden zu geben, der im Bilde ist. Wieso findet Anderson seinen Tageskalender ständig auf den 31. Februar eingestellt? Warum wirken seine Vorgesetzten plötzlich so zugeknöpft? Wer ist der neue Volontär, der allzu eifrig überall und nirgendwo im Büro umhergeistert?
Furcht beginnt in Anderson aufzusteigen, die sich zum Verfolgungswahn steigert und in blanke Panik umzuschlagen beginnt, als die Polizei aufgrund offenbar anonymer Hinweise die Ermittlungen wieder aufnimmt. Inspector Cresse ist ein wenig subtiler, sondern erbarmungslos gründlicher Ermittler, der sich jedes Indiz noch einmal vornimmt. Cresse macht keinen Hehl daraus, dass er Anderson misstraut, weshalb dessen Nöte und Ängste ein nie gekanntes Maß erreichen
Schatten der Schuld
Solange wir nicht selbst betroffen werden, sind wir Menschen (und Leser) in der Lage, uns mit einem Mörder zu identifizieren. Die Kunst eines Schriftstellers kann uns daran erinnern, dass im Hirn jedes Mannes (und jeder Frau) jener Impuls lauert, der uns in die Lage versetzt bzw. dazu treibt, einem Zeitgenossen das Lebenslicht auszublasen. Man versetzt sich erstaunlich leicht in die Rolle eines solchen Pechvogels hinein und leidet deshalb mit, wenn dessen Welt, die besagter Mord eigentlich absichern sollte, aus der Bahn geworfen wird.
Misstrauische Ermittler, argwöhnisch-feindselige Familienmitglieder, abgeschreckte Freunde: Zu der sich aus diesen Quellen speisenden Angst kommen die Reflexionen des eigenen Hirns. Was im Moment der Tat für Erleichterung gesorgt haben mag, verwandelt sich unter dem Diktat des sprichwörtlichen schlechten Gewissens in ein Trommelfeuer aus Schuldreflexen, das die gerade nach einem Mord notwendige Selbstkontrolle unterminiert: Verdachtsmomente müssen zerstreut, Zweifel ausgeräumt und widersprüchliche Aussagen glaubhaft korrigiert werden.
Andy Anderson wird von Julian Symons auf einen Spießrutenlauf geschickt, der noch heute und viele Jahrzehnte nach der Veröffentlichung dieses Romans beeindruckt, fesselt sowie daran erinnert, dass Alter kein die Qualität beeinflussender Makel ist. Zwar mag die Welt, in der sich Anderson bewegt, aus heutiger Sicht gesellschaftlich überholt und auch sonst altmodisch erscheinen, doch die emotionale Ebene des Dramas wirkt taufrisch und zieht umgehend die Leser mit in jenen quälenden Sog, der Anderson mit zunehmender Geschwindigkeit in den Abgrund reißt.
Wenn alles dich jagt
Andersons Furcht vor der Entlarvung nimmt buchstäblich Gestalt an, sobald Inspector Cresse ihn weniger befragt als umgehend mit offensichtlichem Misstrauen in die Zange nimmt - oder ist auch das eine Interpretation seines überforderten Hirns? Aus Andersons Sicht ist Cresse jedenfalls eine Nemesis, die nicht unbedingt einen Fall lösen, sondern ihn in die Enge treiben soll. Jede Äußerung des Polizisten schürt Andersons Angst. Cresse scheint mehr zu wissen, als er publik macht. Spielt er boshaft mit seinem längst im Netz zappelnden Opfer?
Hinter Cresse glaubt Anderson einen unsichtbaren, aber mächtigen Apparat am Werk. Wie Franz Kafka dreht ihn Autor Symons durch ein Mahlwerk, das immer wieder neue Räder enthüllt, unter denen Anderson zerrieben wird. Mit diabolischer Meisterschaft dreht Symons an entsprechenden Schrauben, die sich in Andys Hirn bohren. Seine Sicht der Ereignisse ist wahrlich subjektiv, und hinter trügerisch sachlichen Worten nimmt die Paranoia stetig zu.
Dass Andy Andersons (kleine) Welt so (bedrückend) eindringlich wirkt, liegt sicherlich daran, dass Autor Julian (Gustave) Symons (1912-1994) sie gut kannte: Nach seiner Entlassung aus der Armee arbeitete er ab 1944 für eine Werbeagentur. Schon in diesen Jahren begann er zu schreiben. Seine Kriminalromane, die sich immer wieder auf die Psyche von Opfer, Täter und Ermittler konzentrierten, erreichten eine Meisterschaft, die u. a. von der „British Crime Writers‘ Association“ und der „Mystery Writers‘ Association of America“ mit Preisen gewürdigt wurden.
Obwohl ihn die Literaturkritik als Klassiker des Genres feiert, ist Symons womöglich kein Autor für die Freunde des ‚typischen‘ britischen Krimis. Seine Werke sind selten so simpel gestrickt = auf „den Fall“ beschränkt, wie es das Publikum des „Whodunit“ liebt. Symons dringt in Bereiche vor, in denen es unbehaglich wird. Andy Anderson ist eine Herausforderung für die Leser. Man fiebert und leidet mit ihm, aber man wird sich kaum mit ihm identifizieren. Der Autor verweigert uns jene Züge, die Anderson ‚sympathisch‘ färben würden. Dies setzt Symons fort, indem er ihn - und uns - (s. o.) mit einem geradezu unheimlichen Ermittler konfrontiert. Folgerichtig gipfelt das Geschehen tragisch, aber nicht spektakulär. Andy Anderson geht unter, aber eine ‚gerechte Strafe‘ trifft ihn nicht: eine sehr ‚moderne‘, realistische und die starren Regeln des Rätselkrimis hinter sich lassende Auflösung.
„Der 31. Februar“ im Fernsehen
Angesichts einer Handlung, die sich so intensiv um Schuld und Angst dreht, wundert es kaum, dass Alfred Hitchcock (1899-1980) auf diesen Roman seines Landmanns aufmerksam wurde. Der erfahrene Drehbuchautor Richard Matheson (1928-2013) - selbst ein erfolgreicher Verfasser von Krimi-, SF- und Horrorgeschichten - verfasste ein Script, das Regisseur Alf Kjellin für die legendäre TV-Serie „The Alfred Hitchcock Hour“ (dt. „Alfred Hitchcock präsentiert“) verfilmte. „The Thirty-First of February“ wurde am 4. Januar 1963 (Staffel 1, Episode 15) ausgestrahlt. Die Titelrolle spielte der Schauspielerprofi David Wayne (1914-1995), als Inspector Cresse saß ihm der damals noch nicht ganz so schwergewichtige Joseph Conrad (1920-1994) im Nacken.
Fazit
Einbildung, Schuldwahn oder subtile Rache? Krimi-Meister Symons entwirft nicht nur einen Höllenritt aus Verdacht und Angst, sondern verankert ihn genial in der ebenfalls auf Lug und Trug setzenden Werbebranche der unmittelbaren Nachkriegszeit: ein klassischer Psychothriller der Oberklasse!

Julian Symons, Rowohlt


Deine Meinung zu »Der 31. Februar«
Wir freuen uns auf Deine Meinungen. Ein fairer und respektvoller Umgang sollte selbstverständlich sein. Bitte Spoiler zum Inhalt vermeiden oder zumindest als solche deutlich in Deinem Kommentar kennzeichnen. Vielen Dank!