Film:
Wind River
Film-Kritik von Jochen König
Glück ist etwas für die Stadt. Hier draußen geht es nur ums Überleben.
Es ist selten geworden, aber manchmal reicht ein Trailer, um nachhaltiges Interesse an einem Film zu wecken. So geschehen bei »Wind River«, weit vorm Kinostart am 08.02.2018. Eine beeindruckende Naturkulisse, fernab von plakativen Reisemagazin-Bebilderungen; eine düstere Rachegeschichte, die in einem Indianerreservat spielt und sich mit dem, im Filmkontext gerne unterschlagenen, indigenen Bevölkerungsteil der USA beschäftigt. Als Hauptfiguren firmieren eine junge, starke Frau (eigentlich sind es mit der »Kämpferin« Natalie Hanson sogar zwei), dargestellt von der sehr präsenten Elizabeth Olsen, und ein trauernder Vater, dem Jeremy Renner in Bestform sein zerknautschtes Gesicht leiht. Der als Mann auf der Jagd und trainierter Scharfschütze, die Vergewaltigung und den gewaltsamen Tod einer jungen Indianerin rächen will.

Verantwortlich für dieses Film-Faszinosum ist der Schauspieler (u.a. zu sehen als Akteur in einer der besten Detektivserien der beginnenden 2000er, »Veronica Mars«) und Drehbuchautor Taylor Sheridan. »Wind River« ist nach »Sicario« und »Hell Or High Water« der abschließende Teil seiner »American-Frontier«-Trilogie. Und der erste Film dieser Reihe, den Sheridan selbst inszeniert. Wobei es sich nicht um sein reales Regie-Debüt handelt, denn diese Rolle steht dem kleinen, dreckigen Torture-Porn-Movie »Vile« (»Pain«) aus dem Jahr 2011 zu, das Sheridan aber gerne unter den großen, aufnahmefähigen Teppich der Filmgeschichte fallen lässt. Doch vergessen wir das.
Für »Wind River« erhielt Sheridan bei den Filmfestspielen in Cannes 2017 zu Recht den Regiepreis der Sektion Un Certain Regard. Die exzellente Filmmusik von Nick Cave und Warren Ellis steht auf der Shortlist für die Kandidaten der Oscarverleihung 2018. Da »Wind River« neben all dem auch ein straighter, enorm spannender Rape’n'Revenge-Thriller geworden ist, gibt es mehr als genug Gründe, einen intensiven Blick darauf zu werfen.
Schnee, Gewalt und Jeremy Renner
Spielte »Hell Or High Water« im brütend heißen Texas, reichen die Temperaturen in Wyoming, um das Indianer-Reservat Wind River herum, weit in den Minusbereich. Hier wie dort leben Menschen, ausgebeutet und ausgegrenzt, kämpfen um ihr Überleben. Einsamkeit, im Schatten von wirtschaftlichen und menschlichen Verlusten, ist ein beherrschendes Thema. Die Stille vor dem Schuss. Dass der unweigerlich fallen wird, ist von Beginn an klar. »Wind River« ist, wie seine Vorgänger, ein Neo-Western, ein Film über Jäger, Gejagte, die Jagd überhaupt. Gefangene werden dabei selten gemacht. Es ist auch der Film von Jeremy Renner, der als trauernder Vater und konzentrierter Jäger glänzen kann wie schon lange nicht mehr.
Renner spielt Cory Lambert, Jäger im Dienste des United States Fish and Wildlife Service, der im verschneiten Wyoming einer Pumamutter samt zwei Jungen auf der Spur ist, die einen Jungstier gerissen haben. Zufällig findet er auf der Pirsch die Leiche der 18-jährigen Natalie Hanson, eine Arapaho-Indianerin, die mit ihren Eltern im Wind River-Reservat lebt. Natalie wurde vergewaltigt und floh vor ihren Peinigern mehrere Meilen barfuß durch die klirrend kalte Nacht, bevor ihre Lunge kollabierte, was den Tod zur Folge hatte.

Figuren in einer Landschaft
Lambert wird mit voller Wucht und auf schmerzhafte Weise Zeuge einer Replik seiner eigenen Geschichte, starb seine Tochter doch unter ähnlichen Umständen. Ein Täter wurde (und wird) nicht gefasst, die Ehe mit seiner indianischen Frau zerbrach, Lambert musste sich seiner Trauer und Verzweiflung, trotz Besuch einer Trauertherapie, seiner Arbeit als Wildhüter im Indianer-Reservat und seiner dortigen Freunde, alleine stellen. »Lonely Are The Brave«, diese Einsamkeit, auch unter Menschen, bebildert Sheridan in großartigen Tableaus. Er zeigt Cory Lambert als winzigen Fluchtpunkt in der weiten, schneebedeckten Landschaft, bebildert die Orientierungslosigkeit der jungen FBI-Agentin Jane Banner kurz und knapp durch zugeschneite, verdreckte Autoscheiben und inszeniert einen finalen Shootout, bei dem sich die Beteiligten aufbauen und aus dem Spiel nehmen wie Schachfiguren, verloren auf dem Feld. Zuvor hat sich Banner, die als Notnagel herhalten musste, weil sie zufällig die Bundesbeamtin mit dem kürzesten Weg nach Wind River war, 800 Kilometer vom heißen Las Vegas aus, als resolute und findige Polizistin etabliert.
Gemeinsam leben, einsam sterben
»Das ist keine Gegend für Verstärkung, hier ist man auf sich allein gestellt«, sagt der Sheriff der Stammespolizei Ben Shoyo, als die FBI-Ermittlerin Banner anmerkt, dass sie wohl nicht viel ausrichten könne und Unterstützung ausbleibe. Ganz stimmt dies nicht, denn in entscheidenden Momenten hat Cory Lambert ein scharfschützendes Auge auf Jane Banner. Klugerweise belässt es der Film bei vorsichtigen, freundschaftlichen Annäherungen und verzichtet auf eine anbiedernde Liebesgeschichte zwischen den beiden Hauptdarstellern.
Die unterschiedlichen Gefühlslagen und emotionalen Wechselbäder des gesamten Ensembles werden durchweg äußerst dezent und glaubwürdig vermittelt. Ein wenig Pathos in Cory Lamberts Weisheiten der Trauerbewältigung gehört dazu, doch wirken keine Gefühlsregung, kein wortloses Verständnis und keine Tränen in den Augen harter Männer aufgesetzt. Die Trauer ist echt, gerade weil sie sich, jenseits von persönlichen Schicksalsschlägen, durch alle Lebensbereiche zieht.

Leben am unteren Limit
Nach »Hell Or High Water« schreibt Taylor Sheridan seine Geschichte des Amerikas »von unten« weiter. Sinnbild ist eine schmutzige amerikanische Flagge, die zerschreddert im Wind weht. In Wind River stehen brüchige Trailer, kleine Behausungen, die Bewohner ertragen ihr Leben mit stoischem Stolz oder verzweifeln daran. Die beeindruckende Naturkulisse wird von einer voluminösen Raffinerie verschandelt. Irgendjemand verdient ordentlich Geld in Wind River, die lokale Bevölkerung gehört nicht dazu. Das umfangreiche Werksgelände ist im Winter nahezu verwaist, da kaum Arbeiten ausgeführt werden Die Belegschaft besteht nur aus einer Handvoll Sicherheitsleute, die sich in Langeweile und Suff flüchten. Kontakte zur indigenen Bevölkerung gibt es nur selten, abgesehen von zufälligen Kneipenbegegnungen und einer Liebesgeschichte mit traurigem Ausgang.
Wenn alles still ist, geschieht am meisten*
»Wind River« lässt sich Zeit, hat viel zu erzählen, kann dabei auf überflüssige Erläuterungen verzichten. Viel wichtiger sind Gesten und beiläufige Blicke, eingefangen von genau beobachtenden Kamerabewegungen, die mehr aufnehmen als die Personen, die sich gerade im Bildausschnitt befinden. Das Verbrechen klärt sich fast von selbst, bereits dem Umstand geschuldet, dass in Wind River und Umgebung nicht allzu viele Verdächtige existieren. Das Ende deutet sich früh an, und es wird mehr mit selbstjustiziabler Gerechtigkeit als mit offizieller Rechtsprechung zu tun haben.
Trotzdem ist »Wind River« über seine gesamte Laufzeit hochspannend, gerade weil er sich einem hohen Tempo verweigert, aber im Timing perfekt ist. Weswegen an nur wenigen, entscheidenden Stellen heftige Gewalteruptionen stehen, die glänzend und eigen stilvoll inszeniert sind. Ansonsten tragen die hervorragenden Darsteller, die atemberaubende Landschaft, die eindrücklichen Kamerafahrten und der kongeniale Soundtrack von Nick Cave und Warren Ellis den Film.

Der Versuch einer Verständigung, keine Unterjochung
In einzelnen Kritiken wurde »Wind River« vorgeworfen, dass er eine »paternalistische Aneignung« betreibe, weil Cory Lambert kein indigener Jäger und Fährtensucher sei. Doch okkupiert die von Jeremy Renner gespielte Figur die Position der Ureinwohner nicht. Er ist dank seiner Heirat mit Wilma Crowheart und seiner Empathie den Einwohnern Wind Rivers verbunden. Sein Job, so ist anzunehmen, wird der Gemeinschaft von außen aufoktroyiert. Natalies Bruder, der Kleinkriminelle Chip, wirft Cory in einer Befragungsszene verächtlich vor, dass seine Ex-Ehefrau und seine tote Tochter, die er nicht schützen konnte, ihn nicht zu einem Ureinwohner machen. Cory lässt den jungen Mann kurz und schmerzhaft wissen, was er von dieser Aussage hält. Er weist den jammernden Chip, ob seiner Aussage, dass es keine Perspektiven in Wind River und gleichzeitig keine Möglichkeit gäbe, den Ort zu verlassen, zurecht: »Im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen hier, hattest du alle Chancen rauszukommen. Du hattest die Armee, das College, was auch immer – du hattest die Wahl. Und sieh dir an, was du gewählt hast!« Ein Fingerzeig auf den verranzten Trailer hinter Chip reicht. Cory Lambert ist ein kritischer und mitfühlender Geist, aber er bleibt ein Cowboy. Und das ist auch gut so.
High Noon ist überholt
»Wind River« ist auch kein feministischer Western. Er besitzt mit Jane Banner, überzeugend verkörpert von Elizabeth Olsen, eine starke Frau an zentraler Stelle des Films, aber nicht in dessen Mittelpunkt. Diesen Anspruch erhebt der Film auch gar nicht. Banner ist der Marshall, der von außen in die Stadt reitet, um sie von Übel zu befreien. Olsen spielt den Fremdkörper, der sich ungewöhnlich schnell integrieren kann, konzentriert und präzise. Sie ist ein wehrhafter Charakter, die stehen bleibt, wenn die meisten Männer um sie herum schon flach liegen. Am Ende ist sie dennoch froh, dass sie Unterstützung bekommt. Wenn auch nicht vom FBI. Dass »Wind River« über die verlogene Mentalität des Eine-gegen-Alle á la, »Zwölf Uhr mittags« hinausgeht, zeugt nicht von männlicher Dominanz, sondern von gesundem Menschenverstand.

Ein Film gegen das Vergessen. Im Kino anschauen. Unbedingt!
»Wind River« gefällt außerordentlich als sorgfältig inszenierte Westernspielart des Country-Noir. Der Film schärft den Blick für fast vergessene Gemeinschaften und weist vorm Abspann explizit auf die deprimierende Tatsache hin, dass es, in den von globaler Datenerfassung und möglichst flächendeckender Überwachung geradezu besessenen USA, keine Statistik über vermisste Frauen aus Reservaten existiert. Aus dem Auge, aus dem Sinn: Das ist eine Form von feindlicher Übernahme, die in den Vereinigten Staaten praktiziert wird, seit der erste Weiße einen Fuß auf amerikanischen Boden setzte.
Besonders erfreulich, dass tragende Rollen mit indigenen Schauspieler*innen besetzt sind. So ist nicht nur Sheridans Stammakteur Gil Birmingham im Cast, es gibt auch ein Wiedersehen mit Graham Greene und Apesanahkwat, unvergessen als Maurice Minniefields Gegenspieler Lester Haines in »Ausgerechnet Alaska« (»Northern Exposure«).
Wenn irgend möglich, sollte »Wind River« in einem Kino mit großer Leinwand und exzellentem Sound gesehen werden. Hat der Film verdient.

Cover und Fotos: © Wild Bunch
* Søren Kierkegaard
Informationen
Drehbuch & Regie: Taylor Sheridan
Produktion: Elizabeth A. Bell, Peter Berg, Matthew George, Basil Iwanyk
Musik: Nick Cave, Warren Ellis
Kamera: Ben Richardson
Schnitt: Gary Roach
Besetzung
- Jeremy Renner: Cory Lambert
- Elizabeth Olsen: Jane Banner
- Gil Birmingham: Martin Hanson
- Kelsey Asbille: Natalie Hanson
- Teo Briones: Casey Lambert
- Tantoo Cardinal: Alice Crowheart
- Matthew Del Negro: Dillon
- Hugh Dillon: Curtis
- Julia Jones: Wilma Lambert
- James Jordan: Pete Mickens
- Eric Lange: Dr. Whitehurst
- Martin Sensmeier: Chip Hanson
- Jon Bernthal: Matt Rayburn
- Graham Greene: Ben Shoyo
- Ian Bohen: Evan


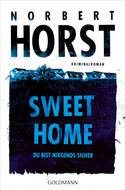

Neue Kommentare